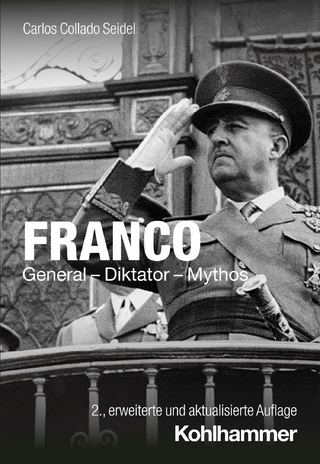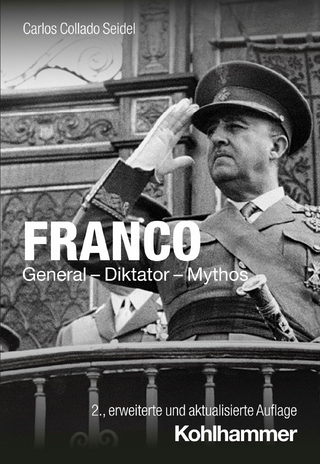Innsbruck im Aufbruch (eBook)
578 Seiten
StudienVerlag
978-3-7065-6452-6 (ISBN)
Marcel Amoser studierte Geschichte, Soziologie sowie Gender, Kultur und sozialer Wandel an der Universität Innsbruck. Zwischen 2018 und 2023 arbeitete er am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck zu Protest und Migration in Tirol. Er promovierte 2023 im Rahmen des Doktoratskollegs 'Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung'. Für seine Forschung wurde er 2024 mit dem Marianne-Barcal-Preis der Stadt Innsbruck ausgezeichnet.
Marcel Amoser studierte Geschichte, Soziologie sowie Gender, Kultur und sozialer Wandel an der Universität Innsbruck. Zwischen 2018 und 2023 arbeitete er am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck zu Protest und Migration in Tirol. Er promovierte 2023 im Rahmen des Doktoratskollegs "Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung". Für seine Forschung wurde er 2024 mit dem Marianne-Barcal-Preis der Stadt Innsbruck ausgezeichnet.
Einleitung
Die 1960er-Jahre gelten als eine Zeit des grundlegenden Umbruchs, der Demokratisierung wie auch Modernisierung. Dies gilt besonders für das mythisch überfrachtete Jahr 1968. Die globalen Studierendenproteste rund um charismatische Figuren wie Daniel Cohn-Bendit oder Rudi Dutschke sind inzwischen gut erforscht und ritualisierter Bestandteil nationaler Erinnerungskulturen.6 Die Bedeutung von „1968“ für Österreich wurde zuletzt im Gedenk- und Erinnerungsjahr rund um das 100-jährige Bestehen der Republik im Jahr 2018 deutlich. In der ursprünglich am „Haus der Geschichte Österreich“ angesiedelten offiziellen Webpräsenz stand 1968 neben dem Revolutionsjahr 1848, dem Gründungsjahr der Republik Österreich 1918, dem „Anschluss“ 1938 sowie 1948, dem Jahr der Verabschiedung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“.7 1968 erfährt damit auch in Österreich eine hohe symbolische Aufladung. Diese Würdigung ist besonders bemerkenswert, waren doch die Studierendenproteste in Österreich weniger radikal und öffentlichkeitswirksam als in Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich oder gar den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Wiener Historiker Fritz Keller beschrieb die österreichische Variante der internationalen Bewegung deshalb als „Mailüfterl“.8
Das mag eine Ursache dafür sein, dass die zeithistorische Erforschung von Protest in Österreich nicht institutionalisiert ist und auch nach wie vor kaum betrieben wird. In dem von den Zeithistorikern Dirk Rupnow und Marcus Gräser 2021 herausgegebenen Band „Österreichische Zeitgeschichte – Zeitgeschichte in Österreich“, mit umfangreicher Standortbestimmung der hiesigen Forschungslandschaft, fehlt dementsprechend ein dezidierter Einzelbeitrag zur 68er-Bewegung bzw. zur jüngeren Protestgeschichte.9 Die Relevanz des Schlüsseljahrs 1968 als vielfältiger Bezugspunkt einer österreichischen Zeitgeschichte machen aber postkolonial inspirierte, queertheoretisch informierte oder auch umweltgeschichtliche Beiträge in derselben Publikation deutlich. Sie markieren damit zugleich ein wichtiges Desiderat der zukünftigen zeithistorischen Forschung.10
Tirol taucht in der Forschung zur Studierendenbewegung bislang nicht auf, sodass sich die Frage stellt, ob bzw. inwiefern es auch dort eine sogenannte 68er-Bewegung gegeben hat.11 Diese Frage soll in der vorliegenden Arbeit mit Fokus auf die Universitätsstadt Innsbruck geklärt werden. Aus der Perspektive der „verlängerten 1960er-Jahre“ soll dabei weit über 1968 hinaus nach Wirkungsketten, Kontinuitäten, Brüchen und Entwicklungen der Studierendenproteste gefragt werden. Wie unten noch besprochen wird, lassen sich dabei idealtypisch verschiedene Phasen unterscheiden: eine Vorgeschichte bzw. Inkubationszeit, eine Zeit des antiautoritären Aufbegehrens, eine der sogenannten K-Gruppen12 und eine der „Neuen Sozialen Bewegungen“ (NSB). Diese Bewegungen lassen sich nicht auf enge weltanschauliche Lager einengen. Sie trugen zu Institutionalisierungsprozessen in Form von Partei- und NGO-Bildungen wesentlich bei, zudem zur Diffusion einer linksalternativen Weltanschauung und zur sukzessiven Verlagerung von der Universität als Ort einer studentischen Trägergruppe13 des Protests hin zu anderen gesellschaftlichen Domänen.
Die NSB, die bezüglich ihrer Trägergruppen wie auch in ideologischer Hinsicht wesentlich breiter gefasst sind, werden in dieser Arbeit nicht gänzlich rekonstruiert, sondern mit Blick auf die involvierten studentischen Gruppierungen und somit aus der „Linse“ der Studierendenbewegung analysiert. Die vorliegende Arbeit befasst sich also vor allem mit Studierenden, dabei erfolgt auch hier eine weitere Eingrenzung auf die sogenannte Neue Linke, die einen wesentlichen Bezugsrahmen für die Studierendenbewegung darstellte. Mit dieser inhaltlichen Klammer geht die Arbeit aber durchaus in die Breite, um die existierende thematische Vielfalt aufzuzeigen und ein Kaleidoskop studentischer Protestepisoden zu entfalten. Dabei handelt es sich um Grundlagenforschung, die ihr primäres Ziel in der Rekonstruktion von zentralen Gruppen und ihren weltanschaulichen Positionierungen, von wichtigen Ereignissen, Protestgründen, Mobilisierungsprozessen und Folgen sowie von wesentlichen Orten und Medien begreift.
Der gewählte Betrachtungsabstand liegt auf einer „Mesoebene“. Sie erlaubt es, punktuell in die Tiefe zu gehen, ohne sich gänzlich auf nur eine Initiative zu beschränken. Sie zielt aber auch auf „dichte Beschreibung“, ohne zu sehr zu abstrahieren oder einen hohen Theorieanspruch zu formulieren. Sowohl weitere Detailanalysen als auch theoretisch abstrahierende Einordnungen und Strukturanalysen sind künftigen anderen Arbeiten vorbehalten. Schließlich will diese Arbeit zunächst Protestgeschichte in den Innsbrucker Stadtkontext und in das historische Narrativ zu den österreichischen 68ern integrieren.
Dabei wird argumentiert, dass die Proteste auf internationale Vorbilder Bezug nahmen, die teils über Medien vermittelt und teils über persönliche Kontakte, Reiseerfahrungen wie auch Migration Wirkung entfalteten. Diese trafen zugleich auf ein stark lokal bestimmtes Wechselspiel von Veränderungs- und Beharrungskräften in der spezifischen Gemengelage der Verhältnisse in Innsbruck bzw. Tirol. Politische, mediale, aber auch kirchliche Strukturen wirkten dabei nicht nur als repressive Kräfte – als Reibungsflächen für Proteste –, sondern öffneten auch (wenngleich stark begrenzte) Freiräume, die impulsgebend für aktivistische Tätigkeiten waren. Einige studentische Gruppierungen entwickelten sich beispielsweise gerade aus bestehenden Parteien (und deren immanenten Konflikten) heraus, darunter auch jene, die einem konservativ-katholischen Milieu zugeordnet werden können. Auch die Dominanz der katholischen Kirche äußerte sich in Innsbruck nicht nur als repressives Vorgehen des Bischofs Paulus Rusch, sondern auch durch das Handeln von liberalen Akteur_innen wie Pater Sigmund Kripp sowie durch die Relevanz von Einrichtungen wie der „Katholischen Hochschulgemeinde“ (KHG). Aus solchen Zusammenhängen ergeben sich spezifische Verlaufsformen, die im Rahmen dieser Arbeit nachgezeichnet werden. Auffallend ist in diesem Zusammenhang immer wieder, dass das Protestpotenzial der Studierenden die etablierten Kräfte weniger durch ihre tatsächliche quantitative Stärke, sondern als Schreckgespenst vor Herausforderungen stellte. Wie etwa die hochschulpolitischen Reformen verdeutlichen, entfaltete aber auch der Protest von kleinen Gruppen eine Wirkung.
Die breite Bewegung blieb nämlich – so viel sei hier vorweggenommen – in Tirol wie in Österreich insgesamt aus. Studierende sahen sich hier vor allem als Zaungäste, die teils mit Faszination und teils mit Ablehnung die Ereignisse in der BRD und in anderen Ländern beobachteten. Sie wurden trotz alledem von der Dynamik der Bewegung erfasst, sympathisierten zwar mit einigen Ideen, distanzierten sich zugleich aber von einem radikalen Vorgehen. Das hängt mit den Trägergruppen des Protests zusammen, die oftmals im dominierenden konservativ-katholischen Milieu verankert waren. Ihr reformorientierter Kurs brach zwar auch mit den vorhandenen Normen und Autoritäten, setzte auf Demokratisierung und führte in der gesellschaftlichen Mitte zu Verschiebungen des Denk-, Sag- und Praktizierbaren, in der Formulierung von Zielvorstellungen blieben die Forderungen oftmals allerdings bescheiden. Abseits davon erhoben vor allem kleine Gruppen, teils freundschaftliche Cliquen den Anspruch, die Gesellschaft von Grund auf, nötigenfalls auch auf revolutionärem Weg zu verändern. In diesen überschaubaren, aber lautstarken Zirkeln nahm auch Gesellschaftspolitik einen großen Raum ein. Man protestierte gegen den Krieg in Vietnam, solidarisierte sich mit Studierenden aus Griechenland oder dem Iran, wandte sich gegen kirchliche sowie staatliche Autoritäten und suchte Alternativen zu konventionellen Formen des Zusammenlebens.
Um der Heterogenität des Themas gerecht zu werden, folgt der Aufbau der vorliegenden Arbeit thematischen Schwerpunkten, die zentrale Facetten der sogenannten 68er-Bewegung abdecken. Nach der Darstellung der wichtigsten Begrifflichkeiten, des zeitlichen Rahmens, des Forschungsstands und der relevanten Quellen und Archive folgt zunächst ein Überblick über die gesellschaftlichen Verhältnisse in Tirol. Vor diesem Hintergrund werden die ersten Studierendenproteste der 1960er-Jahre behandelt, die als Vorgeschichte zu den Auseinandersetzungen am Ende des Jahrzehnts verstanden werden können. Anschließend folgt eine Diskussion der zentralen ideellen Bezugspunkte der Bewegung, die unter der intellektuellen Strömung „Neue Linke“ subsumiert werden können. Danach richtet sich der thematische Fokus auf den Bereich der Hochschulpolitik, vor allem auf verschiedene Tätigkeitsfelder der Studierendenbewegung: Die Aktionen zielten sowohl auf Mitbestimmungsfragen als auch auf Kritik an Autoritäten und mündeten in Reformen der Universitätsorganisation (Universitätsorganisationsgesetz – UOG 1975) sowie der „Österreichischen Hochschülerschaft“14 (ÖH-Gesetz 1973). Der anschließende Themenbereich widmet sich dem...
| Erscheint lt. Verlag | 12.12.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte |
| Verlagsort | Innsbruck |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Zeitgeschichte |
| Schlagworte | 68er • Aktivismus • Demokratisierung • Hausbesetzungen • Katholizismus in Tirol • Kulturwandel • Neue Linke • Protest und Migration • Vietnamkrieg |
| ISBN-10 | 3-7065-6452-1 / 3706564521 |
| ISBN-13 | 978-3-7065-6452-6 / 9783706564526 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 17,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich